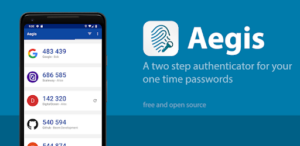Android: Die Fassade der Offenheit bröckelt
Im Server- und Desktop-Bereich hat sich Linux längst als ernsthafte, quelloffene Alternative zu proprietären Betriebssystemen wie Windows und macOS etabliert. Nutzer haben hier die Wahlfreiheit, ihre Systeme von Grund auf anzupassen, Sicherheit selbst zu kontrollieren und die Community voranzutreiben. Doch im mobilen Bereich sieht es ganz anders aus: Android wird zwar häufig als „offen“ bezeichnet, ist de facto aber längst ein Hybrid mit stark proprietärer Prägung – und der verbleibende offene Teil droht weiter zu schrumpfen.

Android: Vom Hoffnungsträger zur kontrollierten Plattform
Ursprünglich galt Android als das Gegenstück zu Apples geschlossenem iOS-Ökosystem. Der Quellcode war über das Android Open Source Project (AOSP) öffentlich einsehbar, was Entwicklern und Moddern weltweit die Möglichkeit gab, eigene Varianten zu erstellen – sei es in Form von Custom ROMs wie LineageOS, /e/OS oder später GrapheneOS, das sich auf Sicherheit und Privatsphäre spezialisiert hat.
Die Realität sah aber schon immer anders aus: AOSP bildet zwar den technischen Kern von Android, doch entscheidende Komponenten – insbesondere jene, die für den normalen Betrieb eines modernen Smartphones unerlässlich sind – wurden frühzeitig ausgegliedert und durch proprietäre Google-Software ersetzt. Dazu gehören vor allem die Google Play Services, die tief in die Funktionsweise des Systems eingreifen: Standortdienste, Push-Benachrichtigungen, App-Kompatibilität – all das hängt zunehmend von dieser Blackbox ab.
Damit ist Android längst kein „offenes Betriebssystem“ im eigentlichen Sinne mehr, sondern ein durch Google kontrolliertes Softwarepaket mit einer offenen Hülle. Ohne die Google-Dienste ist ein Großteil der Apps im Play Store nicht funktionsfähig. AOSP selbst ist im Prinzip nur noch ein minimalistischer Baukasten, der von Projekten wie GrapheneOS oder CalyxOS mühselig zu einem nutzbaren System ergänzt werden muss – oft mit erheblichem Aufwand.
Was ist das AOSP – und was macht es aus?
Das Android Open Source Project (AOSP) ist der öffentlich zugängliche Quellcode von Android. Es bildet das technische Fundament des Betriebssystems – bestehend aus dem Linux-Kernel, Systembibliotheken, grundlegenden Android-Diensten und einer Oberfläche. Der Gedanke dahinter war, Herstellern und Entwicklern eine freie, flexible Plattform zu bieten, auf der sie eigene Android-Varianten aufbauen können.

Doch AOSP enthält nicht alles: Es fehlen sämtliche Google-Apps (Gmail, Maps, Play Store usw.) sowie die tief integrierten Google Play Services, die heute für Push-Benachrichtigungen, Standortdienste, App-Kompatibilität und viele Sicherheitsfunktionen entscheidend sind. Dadurch ist AOSP für den Endnutzer nur ein Gerüst – funktional, aber stark eingeschränkt. Projekte wie LineageOS, CalyxOS oder GrapheneOS bauen auf AOSP auf und ergänzen es mit eigenen oder freien Alternativen, doch der Aufwand ist groß.
Die Illusion der Mitbestimmung
Auch der Entwicklungsprozess war nie wirklich offen. Zwar wurde der Quellcode regelmäßig aktualisiert, doch echte Mitgestaltung war für Außenstehende nicht vorgesehen. Die „Open Handset Alliance“, unter deren Dach Android ursprünglich entstand, klingt zwar wie ein pluralistisches Gremium, war aber von Beginn an fest in Googles Hand. Wer dort mitarbeiten wollte, musste sich strikten Bedingungen unterwerfen – etwa dem Verzicht auf alternative Android-Forks.
Bisher war wenigstens der Code selbst nach Fertigstellung verfügbar – mit etwas Verzögerung zwar, aber doch offen einsehbar. Doch das wird sich nun ändern: Wie kürzlich bekannt wurde, will Google künftig den Entwicklungsprozess von Android weitgehend hinter verschlossenen Türen abwickeln. Das bedeutet: Die Community sieht nicht mehr, wie Android entsteht, sondern erhält nur noch das fertige Produkt, wenn es „ausentwickelt“ ist.
Begründet wird dieser Schritt mit angeblicher Effizienzsteigerung. In Wahrheit ist es wohl ein weiterer Versuch, Kontrolle zu sichern – vor allem darüber, welche Komponenten Android wirklich ausmachen und welche Alternativen es (nicht mehr) geben soll.
Android wird zu "Darwin"
Ein interessanter Vergleich ist Apples macOS: Der technische Unterbau namens Darwin ist ebenfalls Open Source – doch er ist ohne Apples proprietäre Bestandteile nicht benutzbar. Kein Fenster-Manager, keine Apps, kein App Store. Nur ein fragmentiertes Skelett, mit dem man wenig anfangen kann. Google scheint mit Android denselben Weg zu gehen: AOSP wird langfristig ebenfalls zu einer Art „Darwin für Smartphones“ – nutzlos ohne die firmeneigenen Zusatzdienste.
Warum es kaum Alternativen gibt
Die mobile Plattform ist ein hart umkämpftes Feld, das schnelle Entwicklungszyklen, Gerätevielfalt und hohe Nutzererwartungen mit sich bringt. Die Linux-Community, die sich durch Dezentralität, Freiwilligenarbeit und häufige Forks auszeichnet, ist dieser Dynamik strukturell kaum gewachsen. Die Energie, die in Parallelentwicklungen und inkompatible Ansätze fließt, fehlt oft bei der Schaffung einer schlagkräftigen gemeinsamen Plattform.
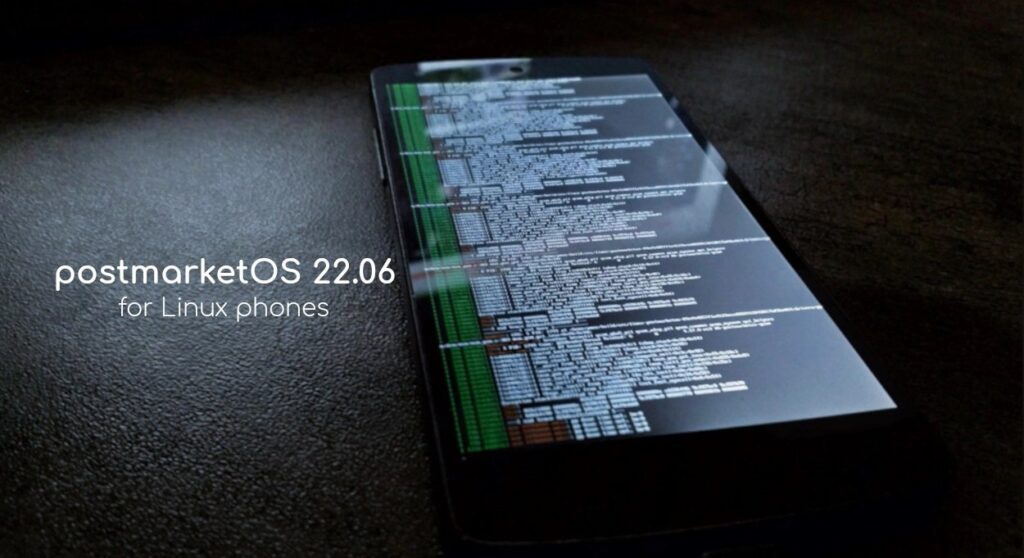
Projekte wie Plasma Mobile oder PostmarketOS zeigen zwar, dass Linux prinzipiell auch auf mobilen Geräten lauffähig sein kann – doch sie kommen über einen experimentellen Status kaum hinaus. Und da die Treiber meist nur als Binärblobs vom jeweiligen Hersteller bereitgestellt werden, ist selbst der Linux-Kernel auf Mobilgeräten selten wirklich frei.
Was bleibt: Hoffnung und Wachsamkeit
Bleibt die Hoffnung, dass Projekte wie GrapheneOS oder CalyxOS weiterhin in der Lage sind, die Lücken zu füllen, die Google mit jeder weiteren Schließung des Android-Ökosystems aufreißt. Ihre Entwickler sind auf ständige Reverse Engineering-Arbeit angewiesen und müssen oft reaktiv auf Änderungen reagieren, ohne echte Einblicke in die geplanten Schritte Googles zu haben.
Der offene Quellcode ist – noch – einsehbar. Doch wie lange das noch der Fall ist, lässt sich nicht abschätzen. Die Richtung ist klar: mehr Kontrolle, weniger Transparenz. Für die Nutzer wird damit die Frage drängender, ob sie dem „offenen Android“ weiterhin vertrauen können – oder ob sie sich nach echten Alternativen umsehen sollten, auch wenn diese unbequem und experimentell erscheinen.